Die Krisen-Kiste
Mariana Romano* leidet seit ihrer Jugend an Depressionen. Die Pandemie und die einhergehenden Kontaktbeschränkungen nehmen ihr das, was sie sonst im Leben gefestigt hat: ihre sozialen Kontakte. Ausgerechnet ihr Job in einer Schweizer Kinder- und Jugendpsychiatrie hilft ihr jetzt durch die Krise.

Ein bisschen versteckt im obersten Regal ihres Kleiderschrankes steht eine kleine, weiße Schachtel. Mariana muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um überhaupt an sie heranzukommen. Darin: neben einem Brief und einigen Postkarten zwei Päckchen mit therapeutischer Knete auf einem Stapel Karteikärtchen. Eine Packung mit sauren Gummibärchen auf einem Mandalabuch. Eine typische Krimskrams-Kiste einer 22-jährigen Studentin. Aber die Kiste ist für Mariana weitaus mehr. Sie ist ihr Notfall-Anker und hilft ihr, mit großem emotionalem Stress umzugehen. „Auch wenn ich die Box in letzter Zeit nicht gebraucht habe, ist es für mich unglaublich wichtig zu wissen, dass ich sie habe.“ Eine der wichtigsten psychischen Übungen, die Mariana immer wieder nutzt liegt auch in der Kiste – eine Babuschka-Puppe.
Seit Mariana 13 Jahre alt ist, hat sie psychische Probleme. Weil ihre Familie nicht über mentale Krankheiten sprach, wurden diese immer schlimmer. So begann sie letztlich sogar sich zu ritzen. Die feinen Narben auf ihren Armen, Beinen und dem Bauch zeugen heute noch davon. Mit 16 war sie in der Psychiatrie. Die Diagnose: Depressionen. Heute lebt die inzwischen 22-Jährige in einer Wohngemeinschaft in Winterthur. Sie sei inzwischen psychisch gefestigt, sagt sie. Die Pandemie bedroht aber diese Festigung – ihr fehlt der Kontakt zu anderen. Der Online-Unterricht und die Kontaktbeschränkungen belasten sie. Was ihr in der Krise hilft: die Arbeit in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Online-Unterricht als Stresstest
In sich zusammengesunken, den linken Fuß auf die Sitzfläche des Schreibtischstuhls aufgestützt und das Knie umarmend, versucht Mariana der monotonen Stimme zu folgen, die aus ihren Laptop-Lautsprechern schallt. In kurzen Abständen wechselt sie auf dem Bildschirm zwischen ihrer Mitschrift, den Dokumenten der Vorlesung und der Videokonferenz. Auf keinem verweilt die Aufmerksamkeit länger als ein paar Sekunden. Ihre Hände wandern unruhig über den Tisch, blättern Briefe und Uni-Unterlagen durch. Die Kopfhörer und die E-Zigarette kommen auf die andere Seite. Wasser ins Glas. Sie tippt nur selten auf der Tastatur. Ihr Handy vibriert ständig.
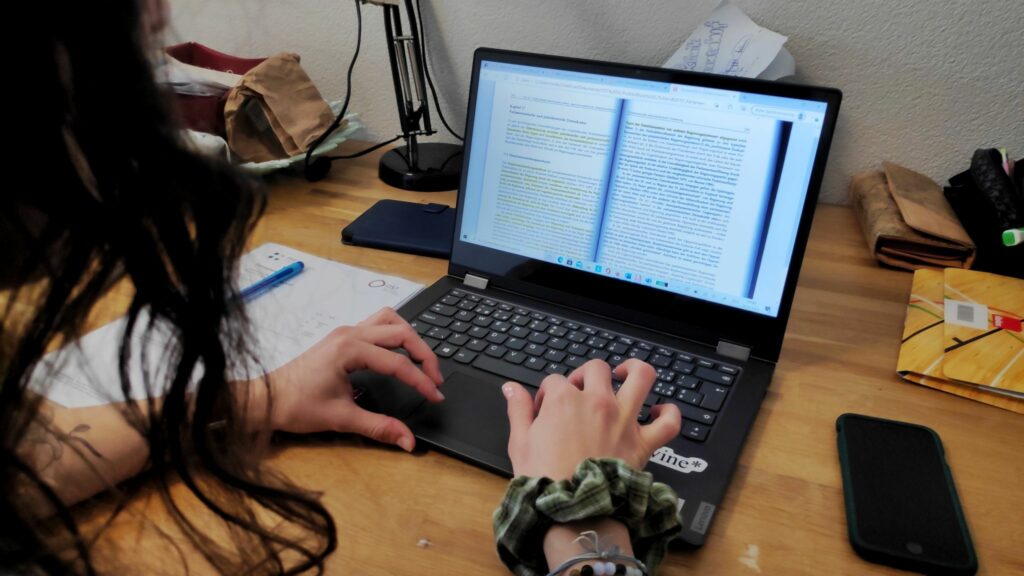
Besonders wenn es ihr psychisch schlechter geht, nimmt diese Suche nach Ablenkungen zu. Sie nutzt jede Möglichkeit um aufzustehen, weg von der Vorlesung zu kommen – egal ob physisch oder psychisch. Zwischendurch liegt sie auch einfach mal mit ihrem Handy im Bett und kuschelt sich in ihre Decken. Die Vorlesung läuft währenddessen weiter.
Besonders junge Erwachsene sind betroffen
Mariana ist eine von mehr als 250 Tausend Studierenden in der Schweiz. Sie und viele Gleichaltrige sind derzeit für ihr Studium vor dem Bildschirm und damit an den heimischen Schreibtisch gefesselt. Das kann zur Belastungsprobe werden. Besonders wenn die Situation zudem durch eine psychische Vorerkrankung verschärft wird. Die Geduld nimmt ab. Ihre Stresstoleranz sinkt, sie ist schnell genervt und genau deshalb unzufrieden mit sich selbst und anderen
Ein Bericht des Bundesamtes für Gesundheit identifiziert Jugendliche und junge Erwachsenen als eine der besonders durch die Pandemie betroffenen Gruppen. 23 Prozent der 18- bis 24-Jährigen gaben in einer Umfrage der AXA an, dass sich die Covid-19-Situation schlecht oder sehr schlecht auf ihre psychische Gesundheit ausgewirkt habe. Das sind mehr als in jeder anderen Altersgruppe.
Die Psychiatrie wurde zur wichtigsten Stütze
Kopfhörer auf, Maske an und Handy in der Hand. Mariana schottet sich ab. Die schnellen und fröhlich wirkenden Beats, die auch noch auf dem Platz neben ihr im Bus leise zu hören sind, gehören zu einem Ritual, mit dem sie sich auf das vorbereitet, was vor ihr liegt – die Arbeit in einem psychiatrischen Kinder- und Jugend-Zentrum.
Seit August 2020 arbeitet sie fest als Sozialpädagogin in Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik. Sie ist für die Patientinnen und Patienten Ansprechpartnerin für alles, was außerhalb der Therapiestunden passiert – Gruppensitzungen, Förderung von Sozialkompetenzen und Alltagsplanung gehören zu ihren Aufgaben. Ihre eigenen Erfahrungen helfen ihr bei dieser Arbeit, denn sie kann nachvollziehen, wie es den Jugendlichen geht.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
„Ich habe im vergangenen Jahr gelernt, mehr auf mich zu hören.“ Und dazu gehört, dass auch ihre Arbeit ein Anker in dem Corona-Chaos geworden ist. Sie gibt ihr einen festen Rhythmus vor, sie erlaubt es, mit anderen Menschen kontinuierlich in Kontakt zu treten, auch trotz Kontaktbeschränkungen.
Den Frust von der Seele tanzen
Mariana sucht Rituale. Und Begegnungen. Die Balance zwischen emotionalem Kontakt und physischer Distanz ist für sie schwierig. Deswegen gibt es eine Handvoll Menschen mit denen sie sich regelmäßig und damit auch ohne Maske entsprechend der Schweizer Kontaktbeschränkungen trifft.
Schon auf dem Weg zu einem Freund aus dem Musical-Verein, in den sie 2019 eingetreten ist, wirkt Mariana befreit. Die Anspannung der Online-Vorlesungen scheint wie weggeblasen. Sie lächelt mehr und wippt beschwingt mit den Beinen zu dem Rhythmus der Musik aus ihren Kopfhörern. Bei ihrem Kollegen angekommen, verschwindet sie auf direktem Wege im Bad – Maske abziehen, Hände waschen und umziehen – und danach: Lange Umarmungen, viel Körperkontakt und liebe Worte. Mariana lädt ihre emotionalen Batterien auf.
Nachdem die beiden gemeinsam Esstisch und Sofas zur Seite geschoben haben tanzen sie durchs Wohnzimmer. Natürlich ist das nicht perfekt, das ist den beiden absolut klar, aber darum geht es auch nicht. Der Fokus liegt auf dem Spaß an der Bewegung, der Freude der Interaktion und dem Sich-Fallenlassen-Können-Gefühl das zwischen den beiden aufkommt, wenn Mariana in den Armen ihres Freundes liegt.
Die letzten Monate waren nicht einfach für Mariana Romano. Sie hat das vergangene Corona-Jahr, in dem es für viele sehr still geworden ist, dazu genutzt, zu lernen, noch mehr auf sich und ihre Bedürfnisse zu hören. Und genau darin sieht sie auch einen Vorteil der Pandemie, denn „ganz viele Leute konnten sich endlich die Zeit nehmen, um zu schauen, was ihnen guttut, was sie brauchen, denn mehr Menschen haben psychische Probleme, als man denkt.“
*Name wurde geändert